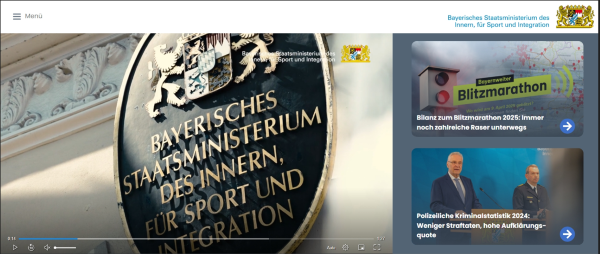Zum ersten Führungsunterstützungsseminar im Jahr 2025, das in Anlehnung an die Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes Bayern durchgeführt wurde, konnte Kreisbrandmeister Markus Rohmann in Hohl insgesamt 24 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus verschiedenen Feuerwehren des Landkreises Aschaffenburg begrüßen.
Ziel des Seminars war es, den Besatzungen von Mehrzweckfahrzeugen (MZF) und Einsatzleitwagen (ELW 1) die theoretischen Grundlagen im Bereich der Einsatzleitung sowie der Einsatzabschnittsleitungen bis hin zur Führungsstufe B zu vermitteln. Diese speziell geschulten Kräfte sollen künftig die örtlichen Einsatzleiter bei größeren Einsatzlagen aktiv unterstützen. Im Landkreis Aschaffenburg werden diese Führungsfahrzeuge bereits ab bestimmten Einsatzstichworten regelmäßig mitalarmiert und übernehmen zunehmend wichtige Führungsaufgaben.
Das Seminar erstreckte sich über zwei Abendveranstaltungen.
Am ersten Abend standen insbesondere rechtliche Grundlagen, das Führungssystem der Feuerwehr sowie die wesentlichen Dokumentationsaufgaben wie Einsatztagebuch und Lagekarte im Mittelpunkt.
Der zweite Abend widmete sich praxisnahen Themen wie der sinnvollen Beladung der Führungsfahrzeuge, dem Einsatz technischer Hilfsmittel sowie der Informationsgewinnung und -übermittlung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zudem Einblicke in digitale Werkzeuge wie Fireboard, what3words und ein Crash-Recovery-System. Ergänzend wurden auch analoge Hilfsmittel wie Gefahrgutnachschlagewerke, topographische Karten und selbsterstellte Einsatzpläne vorgestellt und deren Nutzen im Zusammenspiel mit digitalen Systemen diskutiert.
Ein besonderer Schwerpunkt des Seminars lag auf dem Übergang von der analogen zur digitalen Führungsunterstützung und den Chancen, die sich aus der Kombination beider Welten ergeben.
Kreisbrandmeister Markus Rohmann dankte allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, zukünftig Aufgaben in der Führungsunterstützung zu übernehmen. Die im Seminar gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen werden in die Planung des nächsten Lehrgangs einfließen, der im Herbst in Bessenbach stattfinden soll.

Bild: Uwe Waldschmitt, FF Mömbris-Hutzelgrund